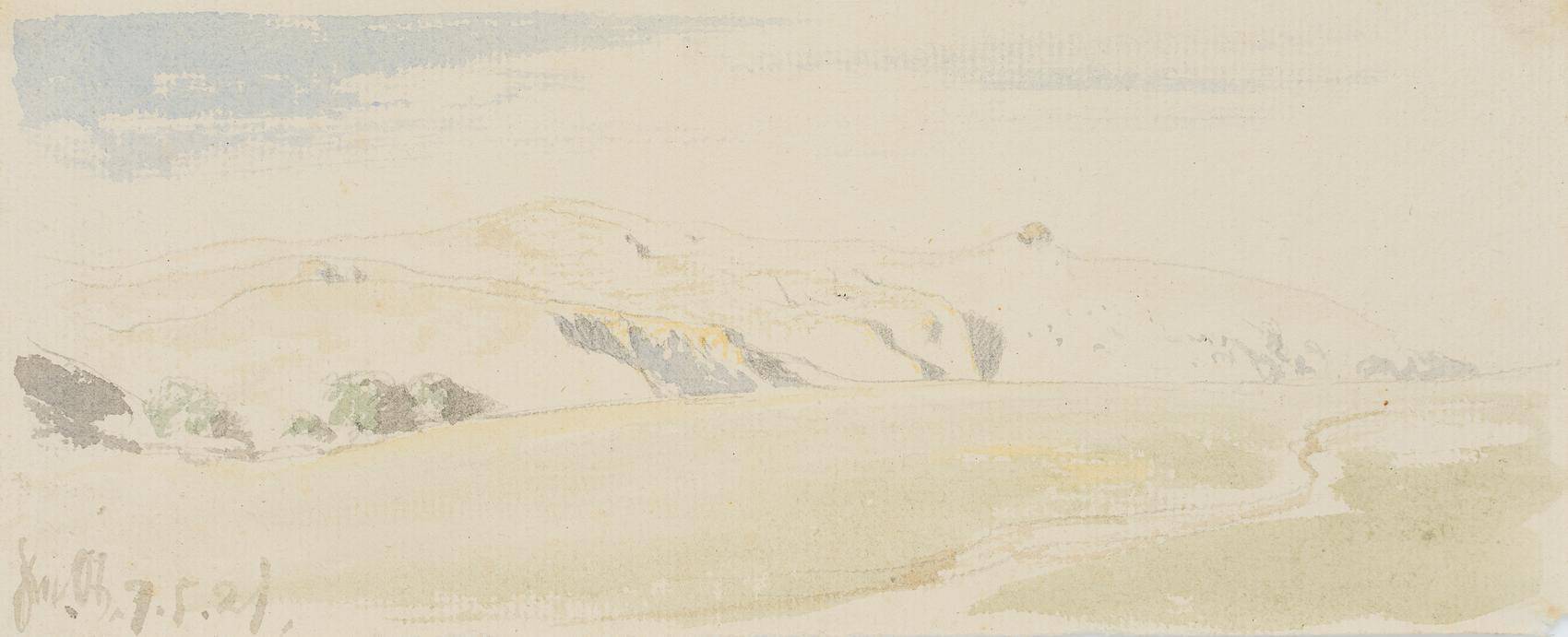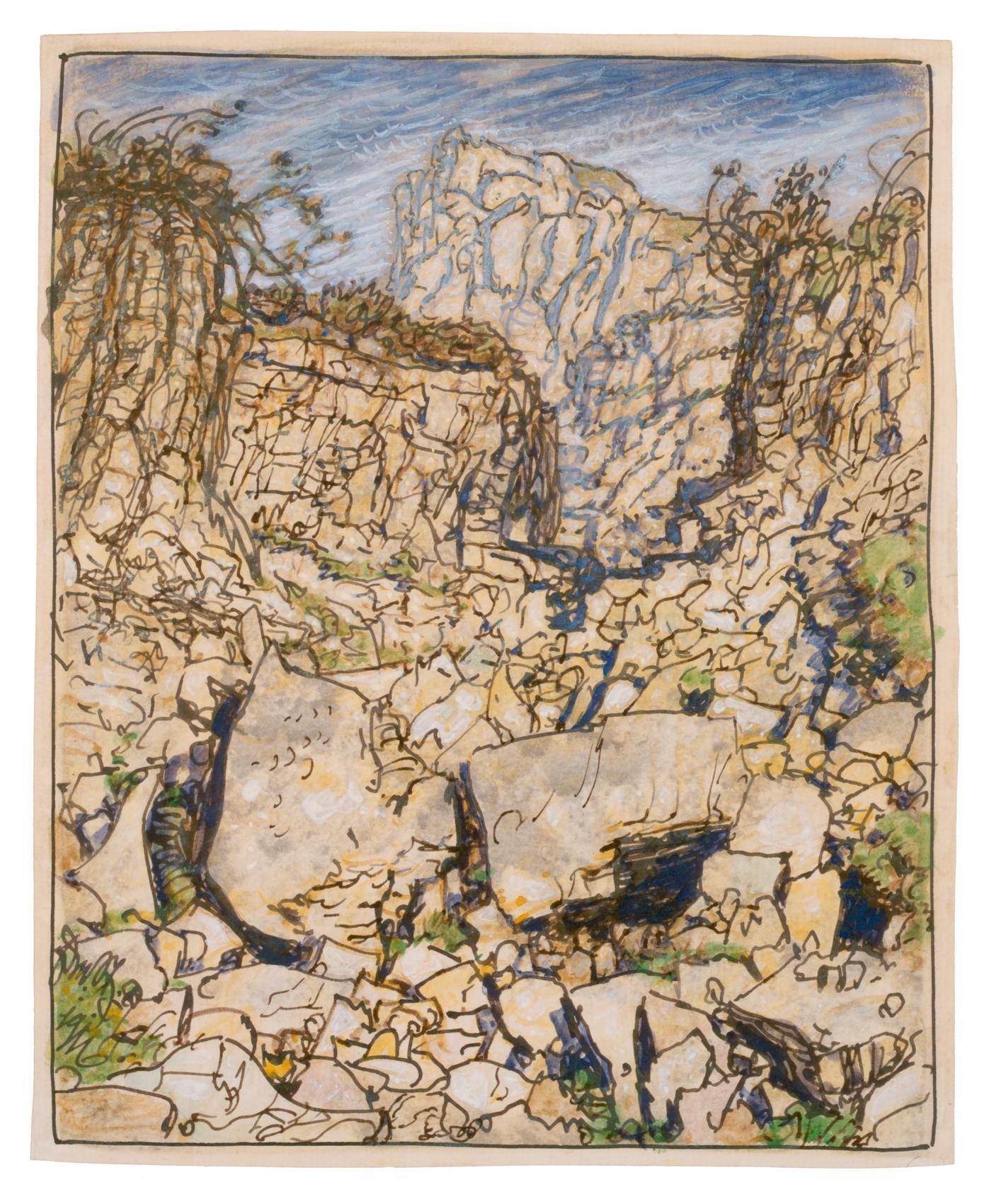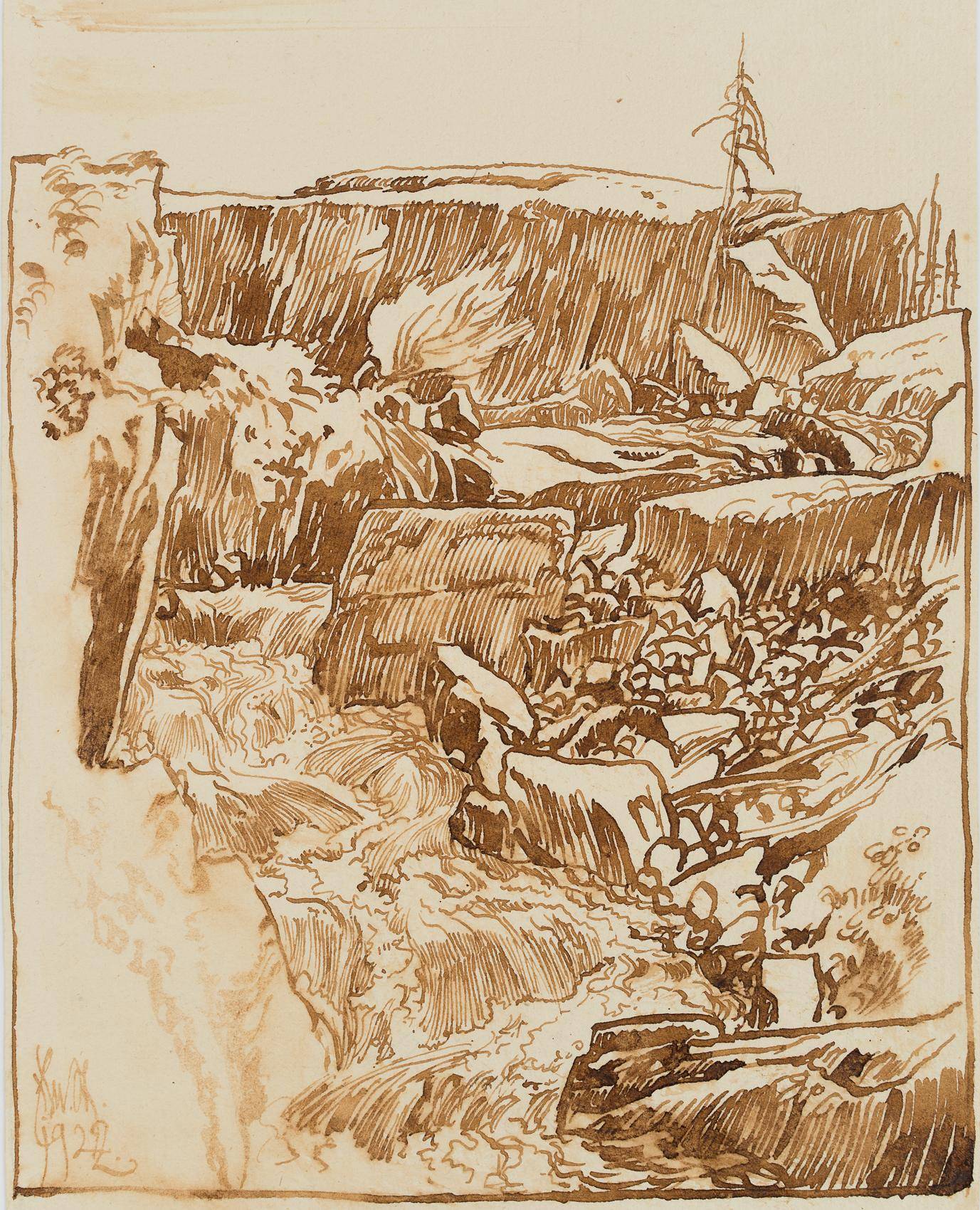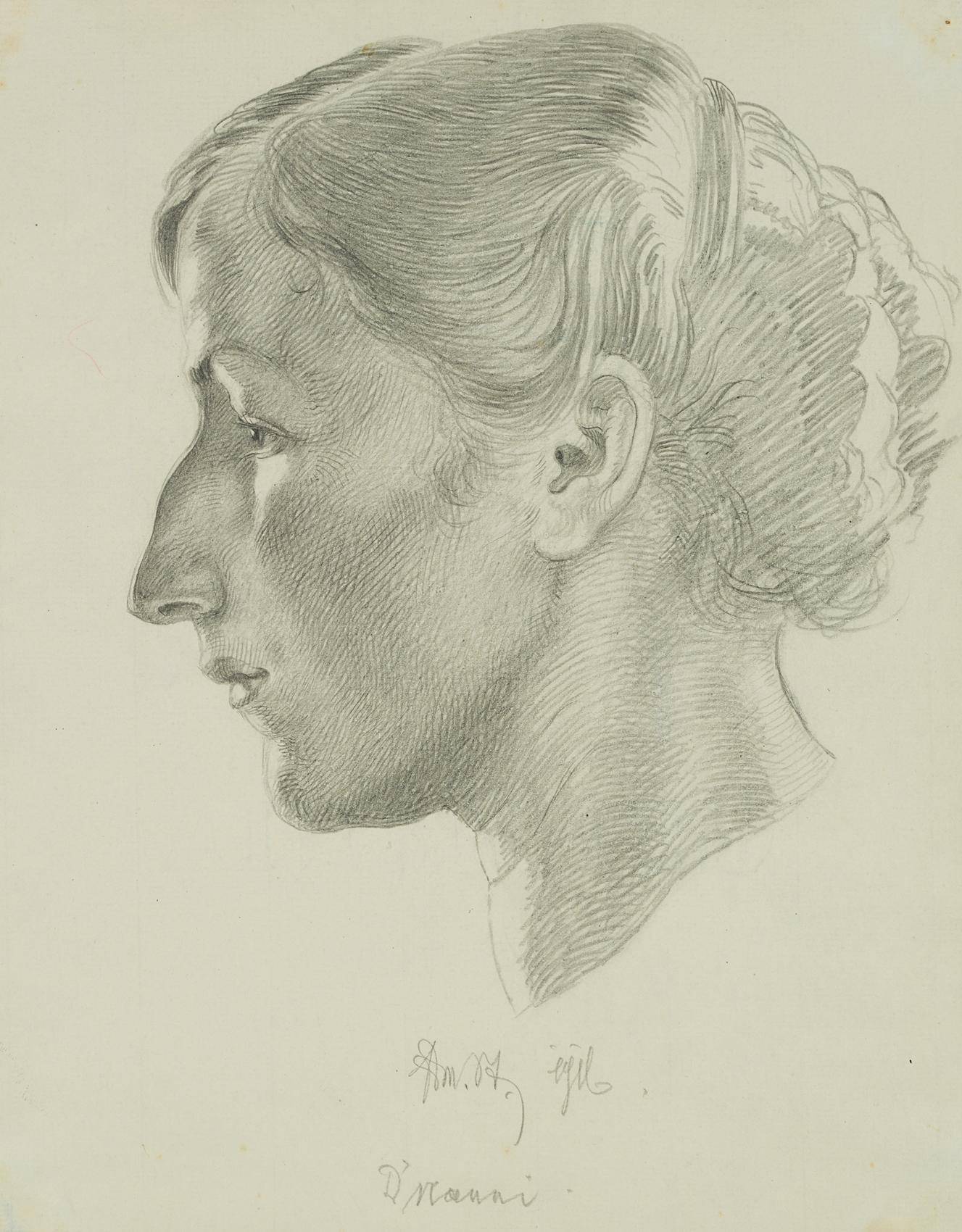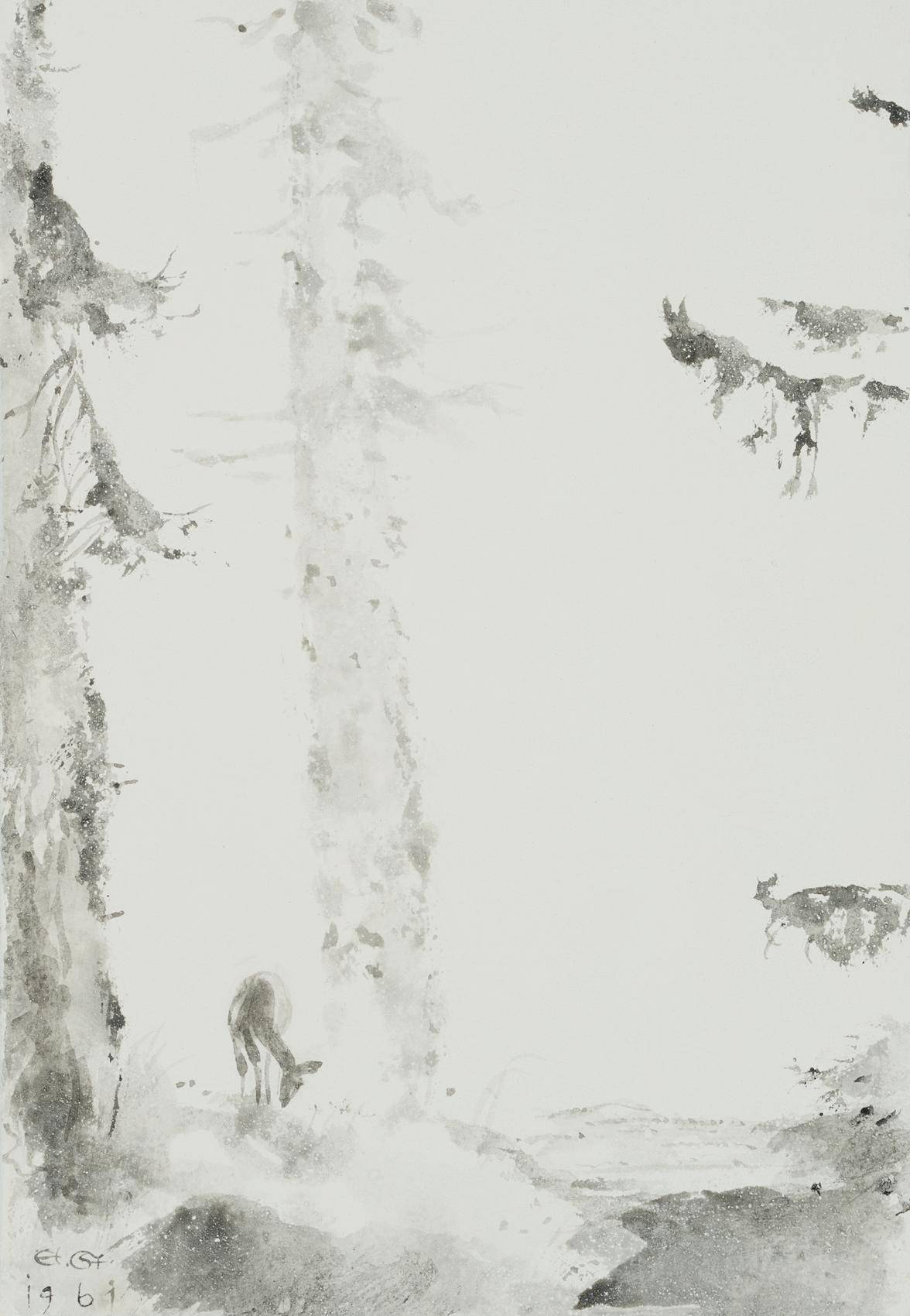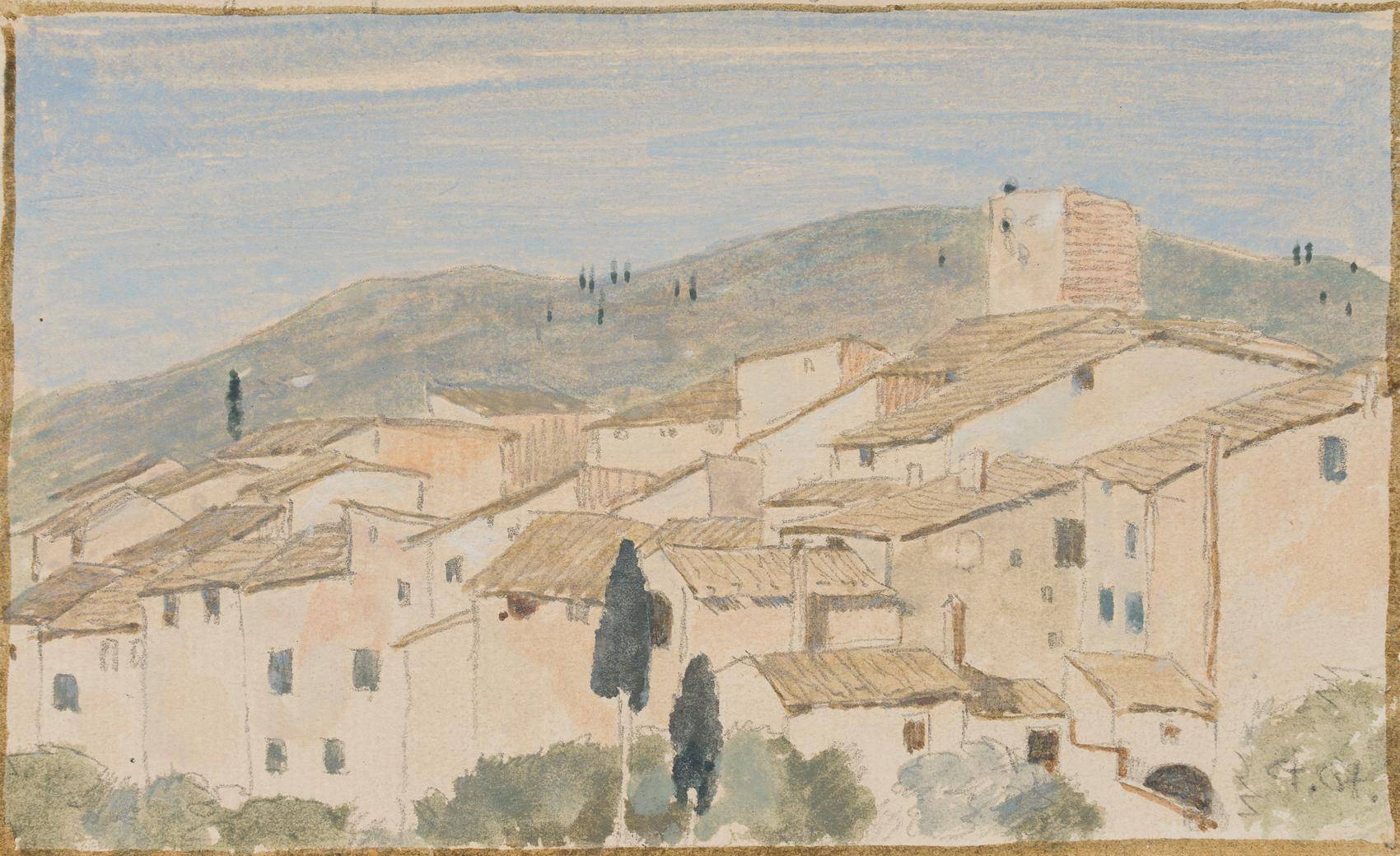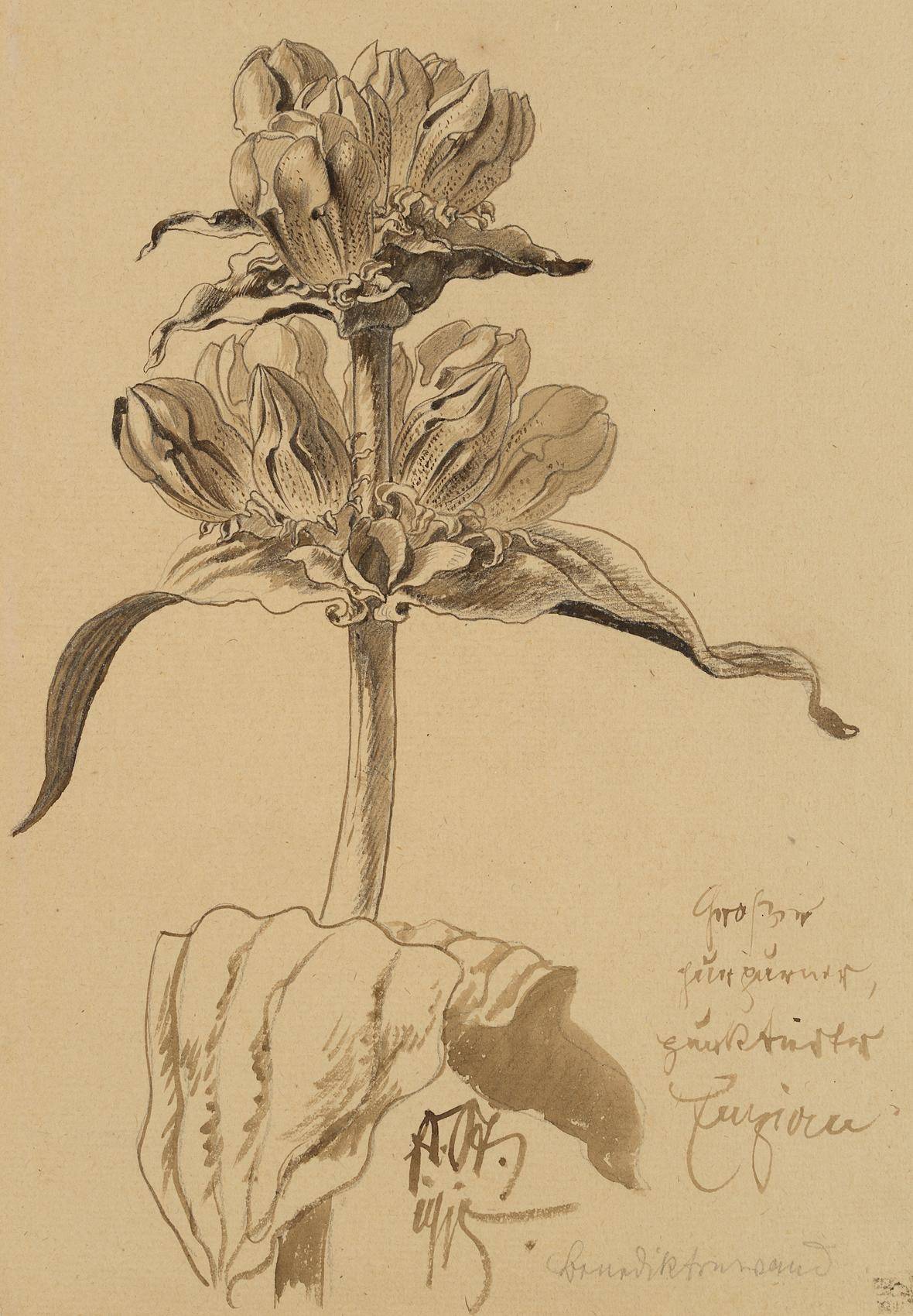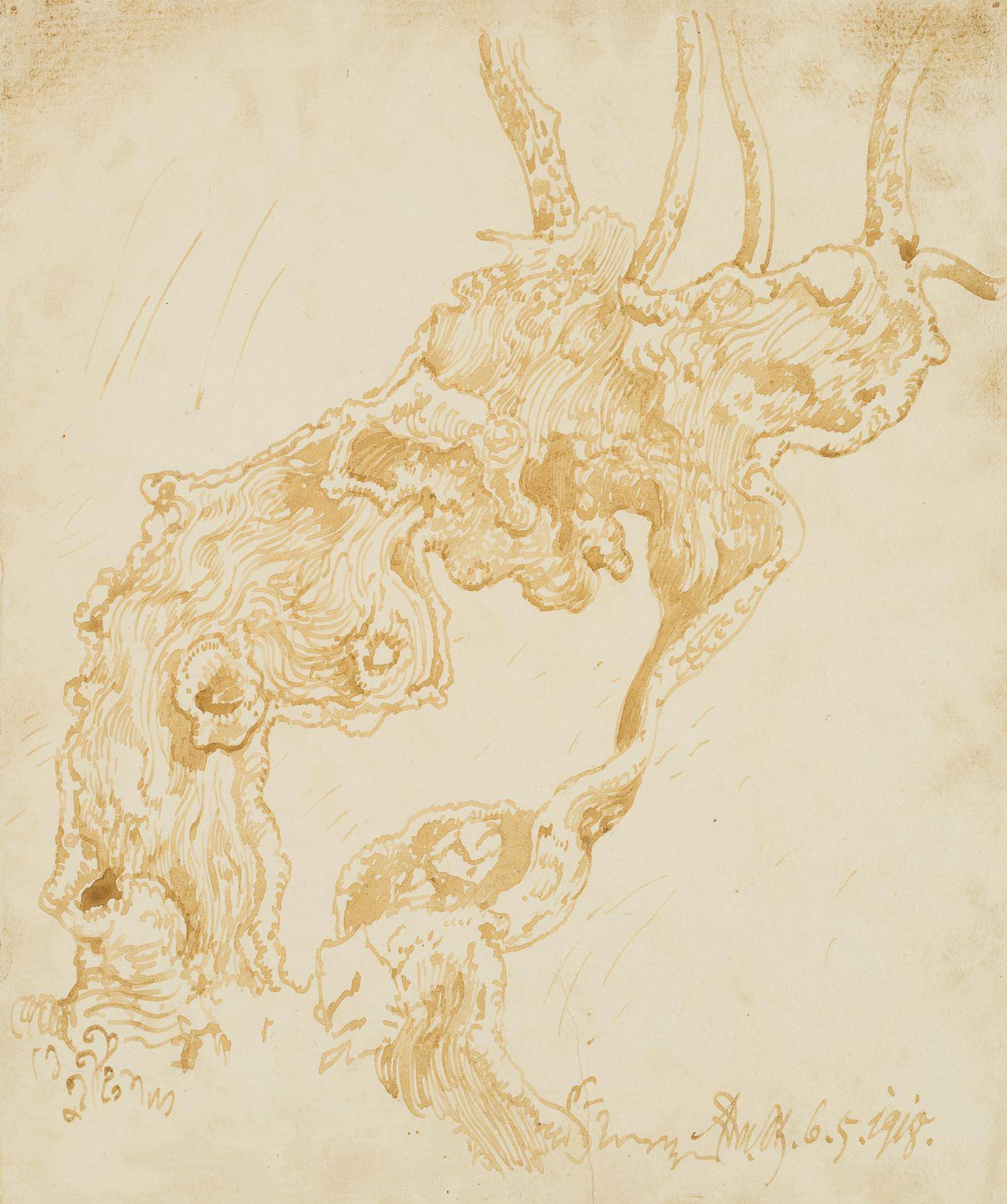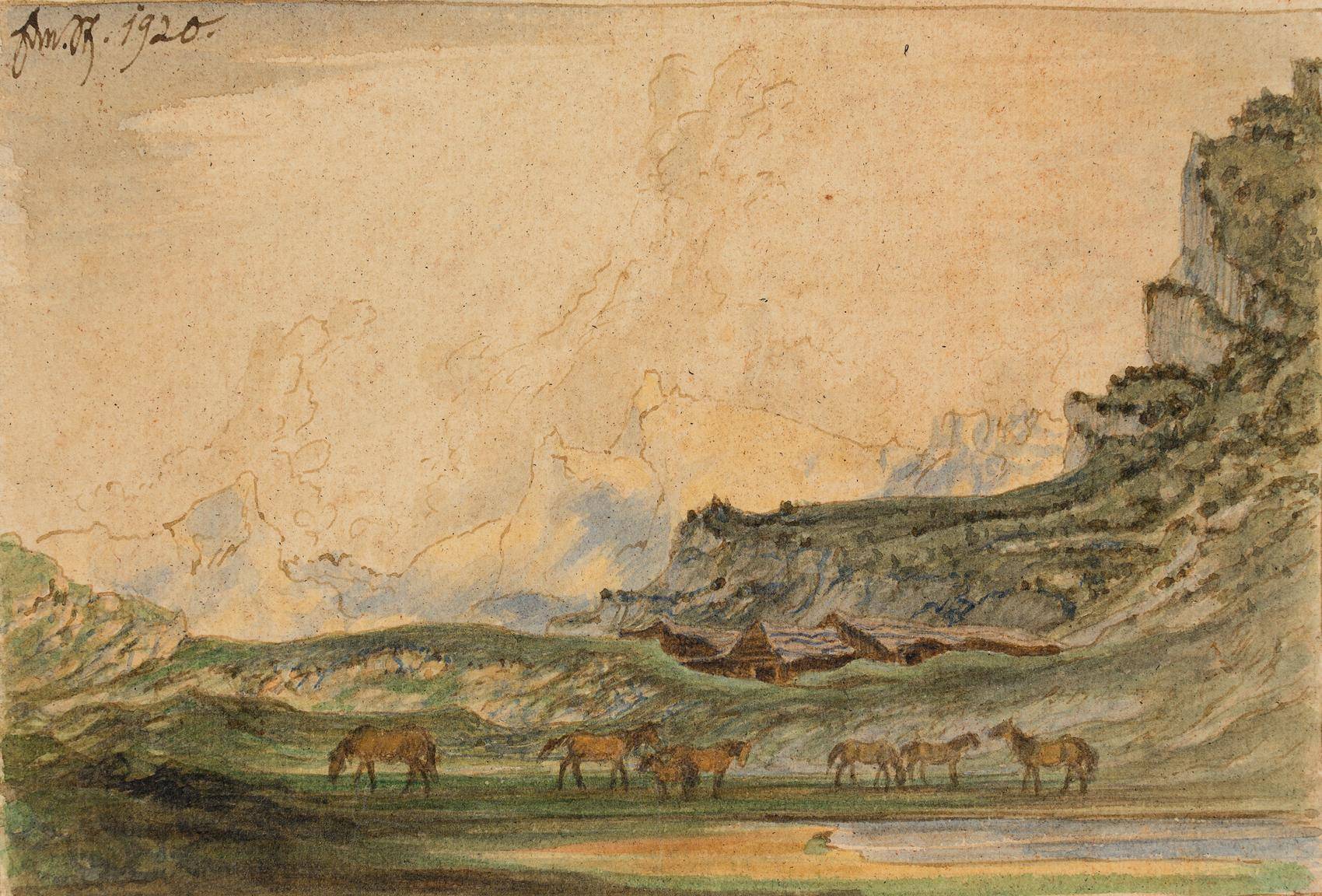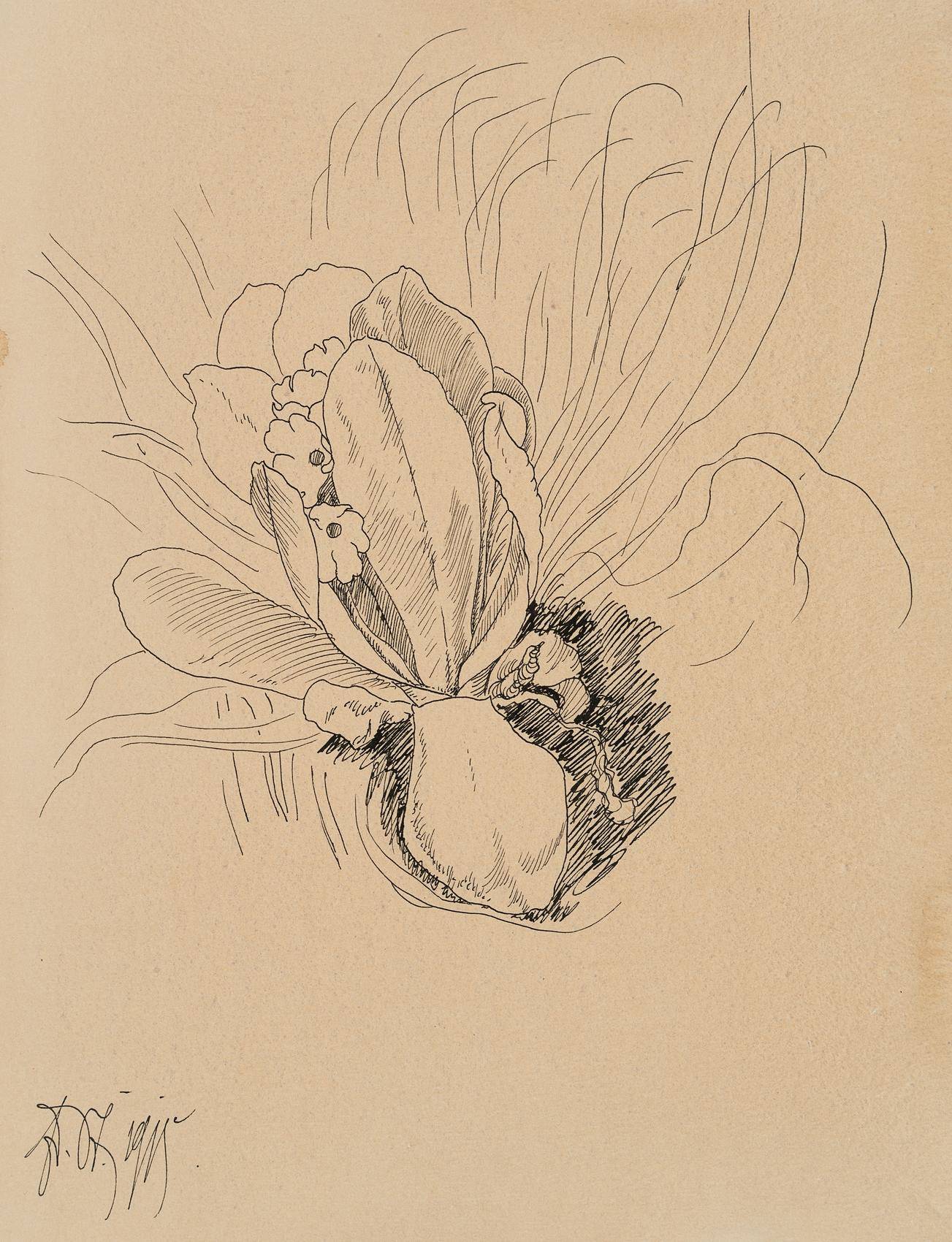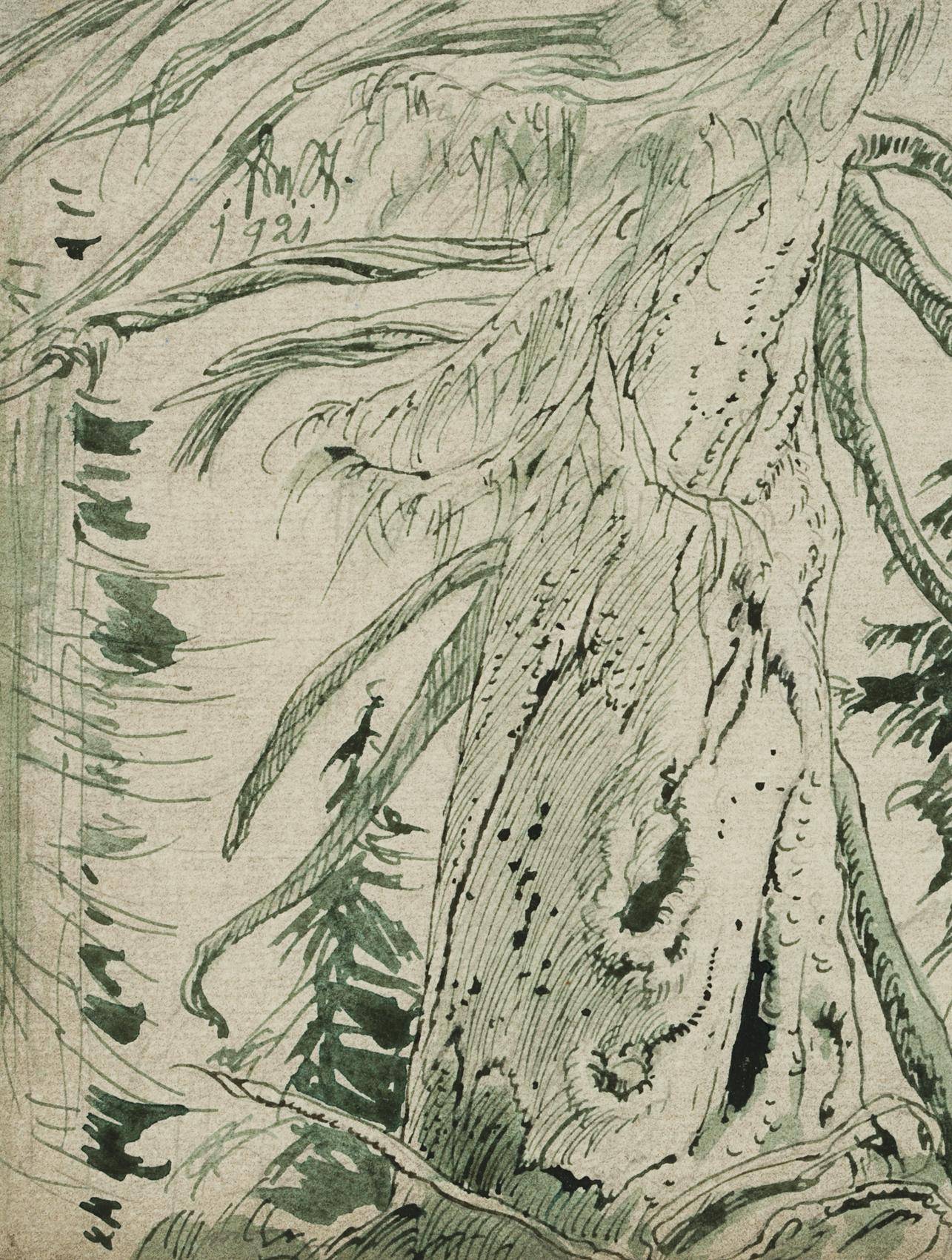Edmund Steppes wurde 1873 in Burghausen geboren und besuchte von 1893 bis 1895 die Münchner Akademie. Bald erlangte er Berühmtheit und stellte seine Werke im In- und Ausland aus. Als Landschaftsmaler wurde er für einen innovativen Stil aus impressionistischen Impulsen mit konservativen Tendenzen bekannt. Die Weltkriege prägten das Schaffen des Malers: 1914 vom Wehrdienst befreit, war er in den 1930er und 1940er Jahren auf der „Großen Deutschen Kunstausstellung“ vertreten. Er stellte zwar die politische Akzeptanz seiner Kunst unter Beweis, durch die Absenz ideologisch überhöhender Szenen und Figuren lässt sich in den Landschaften allerdings keine Instrumentalisierung für Propagandazwecke erkennen. 1945 wurden Atelier und ein Großteil seiner Werke zerbombt und Steppes siedelte nach Ulrichsberg. Nach Kriegsende wurde er als Mitläufer zu einer Geldstrafe verurteilt, jedoch von der Anklage befreit. 1948 zog er nach Tuttlingen und er erfuhr diverse Ehrungen, darunter das Bundesverdienstkreuz am Bande. Drei Jahre vor seinem Tod ging Steppes zurück nach Ulrichsberg und verstarb dort 1968.
Höchste Qualität
Bei uns erwerben Sie nur Originale aus der
angegebenen Zeit, keine Kopien oder
Reproduktionen!
angegebenen Zeit, keine Kopien oder
Reproduktionen!
Besonderer Schutz
Alle Kunstwerke auf Papier sind durch ein
spezielles Klapp-Passepartout aus Karton nach
Museumsstandard geschützt!
spezielles Klapp-Passepartout aus Karton nach
Museumsstandard geschützt!
Ein Monat Rückgaberech
Alle Ihre Einkäufe können Sie innerhalb eines
Monats kostenlos zurückgeben!
Monats kostenlos zurückgeben!
Schneller Versand
Alle unsere Kunstwerke und Bücher sind vorrätig und
werden innerhalb von einem Tag nach Ihrer
Bestellung verschickt"!
werden innerhalb von einem Tag nach Ihrer
Bestellung verschickt"!